|
3 Grundlagen der
Kommunalverwaltung
3.1 Aufgaben und Strukturen
3.1.1 Begriff, Anzahl und
Größenklassen
Der Begriff „Kommune“ dient als
Sammelbegriff für kreisfreie
Städte, Gemeindeverbände (insbesondere Kreise)[38],
kreisangehörige
Städte und kreisangehörige Gemeinden.[39] Städte und
Gemeinden werden
gesetzlich unter dem Begriff „Gemeinden“ zusammengefasst. Die rund 82,5
Millionen Einwohner Deutschlands[40] verteilen sich auf 12.629
Gemeinden unterschiedlichster Größenordnungen, die in der
folgenden
Statistik aufgeführt sind:
Tabelle 2: Anzahl und Einwohnerzahlen
der Gemeinden Stand 31.12.2003
Zahl der
|
Einwohnerzahl
|
Gemeinden
|
von
|
bis
|
204
|
< 100
|
539
|
100
|
200
|
2021
|
200
|
500
|
2315
|
500
|
1.000
|
2221
|
1.000
|
2.000
|
1158
|
2.000
|
3.000
|
1302
|
3.000
|
5.000
|
1296
|
5.000
|
10.000
|
875
|
10.000
|
20.000
|
507
|
20.000
|
50.000
|
109
|
50.000
|
100.000
|
44
|
100.000
|
200.000
|
26
|
200.000
|
500.000
|
9
|
500.000
|
1.000.000
|
3
|
> = 1.000.000
|
Quelle: Eigene Darstellung, in
Anlehnung an: Statistisches Bundesamt (2004)
Mit Ausnahme von 116 kreisfreien
Städten gehören die Gemeinden 323 (Land-)Kreisen an, die
überörtliche Aufgaben wahrnehmen.
3.1.2 Einordnung im Staatswesen
Die Kommunen sind
Gebietskörperschaften[41] des öffentlichen Rechts.
Sie gehören verfassungsrechtlich zu den Ländern und stellen
insofern
keine selbständige Ebene dar. An der Gesetzgebung haben Kommunen
nur
geringe Mitwirkungsrechte. In Bund und Ländern beschränken
sich die
Rechte i. d. R. auf die Anhörung der kommunalen
Spitzenverbände. Auf
Ebene der EU sind die Kommunen im Ausschuss der Regionen vertreten, der
im europäischen Rechtsetzungsprozess allerdings nur eine schwache
Stellung hat.[42]
3.1.3 Aufgaben
Die Kommunen haben die Aufgabe, das
Wohl ihrer Einwohner zu fördern.
Um dies zu ermöglichen, wird den Kommunen in Art. 28 Abs. 2 des
Grundgesetzes das Recht auf kommunale Selbstverwaltung eingeräumt.
Neben freiwilligen Aufgaben (z.B.
Angebot von Freibädern, Museen)
müssen Kommunen auch zahlreiche Aufgaben wahrnehmen, die ihnen vom
Bund
oder von den Ländern übertragen werden.
Zwischen den Kommunen bestehen
erhebliche Unterscheide in der
Aufgabenwahrnehmung, die sich aus mannigfaltigen Ursachen wie z.B. der
Größe, Landeszugehörigkeit, politischen Mehrheiten, der
Finanzkraft
oder der Geschichte herleiten.
Der Produktrahmen für
Kommunen[43] gibt einen groben Überblick über die
vielfältigen und heterogenen Aufgaben der Kommunen.[44]
Abbildung 4: Kommunaler Produktrahmen;
hier: Produktbereiche (schwarze Schrift)
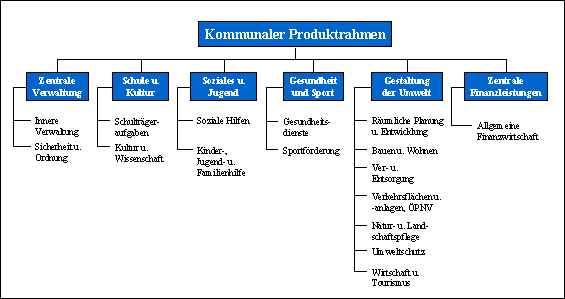
Quelle: Eigene Darstellung
Jeder Produktbereich besteht aus
mehreren Produktgruppen, die sich
regelmäßig in mehrere Produkte unterteilen. Diese weitere
Unterteilung,
die für Kommunen nicht verbindlich ist, wird am Beispiel des
Produktrahmens NRW dargestellt.
Tabelle 3: Auszug aus dem
Produktrahmen des Landes NRW, Stand 31.12.04
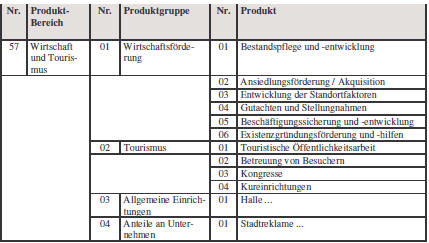
Quelle: Innenministerium NRW (2004)
3.1.4 Organe
Da das Recht der Kommunalverfassung eine
Aufgabe der Länder darstellt,
gibt es in der Definition und Ausgestaltung der Organe Unterschiede, so
dass an dieser Stelle nur häufig anzutreffende Konstellationen
wiedergegeben werden. In allen Ländern werden der
Bürgermeister bzw.
Landrat und der Rat als Organe der Kommunen definiert. Aus dem Rat
bilden sich daneben die Ausschüsse als Teilorgane. In einigen
Bundesländern sind darüber hinaus für größere
Städte
Bezirksvertretungen und Bezirksvorsteher vorgesehen. Weitere oder
abweichende Organe sind in den kommunalen Unternehmen vorhanden.
Es ist regelmäßig
vorgesehen, dass Rat und Bürgermeister von den Bürgern
für 5 Jahre gewählt werden.
Der Rat entscheidet über wichtige
und grundlegende Angelegenheiten
der Kommune. Er ist – mit Ausnahme der Stadtstaaten - Teil der
Exekutive und kein Parlament. Je nach Einwohnerzahl der Kommune setzt
sich der Rat aus 20 bis 90 Mitgliedern unterschiedlichster Berufe und
Qualifikationen zusammen, die das Ratsmandat ehrenamtlich ausüben.
Innerhalb des Rates gründen sich regelmäßig Fraktionen
der politischen
Parteien. Zur Beratung oder Entscheidung spezieller Themen bildet der
Rat Ausschüsse.
Der Bürgermeister (in kreisfreien
Städten der Oberbürgermeister)
leitet die Verwaltung, wozu ihm ein umfassendes Organisationsrecht
zusteht. Er vertritt und repräsentiert die Kommune, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und hat den Vorsitz im Rat. Im Rat hat
der
Bürgermeister das gleiche Stimmrecht wie ein Ratsmitglied.
Über
einfache Geschäfte entscheidet er selbständig.
Die Bürger stellen kein Organ
dar, verfügen aber neben dem Wahlrecht
über weitere Rechte, mit denen sie Einfluss auf die Gestaltung der
Kommunen ausüben können (z.B. Information und Anhörung,
Bürgeranträge,
Bürgerbegehren, Bürgerentscheide).
3.1.5 Organisation und Personal
Die Kommunen nehmen ihre Aufgaben in
vielfältigen
öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Rechts- und
Organisationsformen wahr. Der Trend zur Ausgliederung von
Verwaltungsbereichen hat sich in jüngerer Zeit weiter
verstärkt.[45]
Nach einer Umfrage im Jahr 2002 unter Kommunen mit mehr als 50.000
Einwohnern beträgt der Personalanteil der Beteiligungen 46 %.[46]
Die Ausgliederungen werden vielfach
als „kommunale Unternehmen“
bezeichnet. Dieser Bezeichnung liegt keine gesetzliche Definition
zugrunde.[47] In dieser Arbeit wird das kommunale Unternehmen definiert
als „Unternehmen, dessen Anteile zu 50 % oder mehr von einer oder
mehreren kommunalen oder regionalen Gebietskörperschaften gehalten
werden, oder das - wenn sie weniger als 50 % halten - in der Praxis
ganz von diesen Gebietskörperschaften kontrolliert wird.“[48]
Die am häufigsten gewählten
Organisationsformen von kommunalen
Unternehmen sind die GmbH (73 %), Eigenbetriebe[49] (9 %), die AG (5 %)
und Zweckverbände[50] (5 %).[51] Als Gründe für
Ausgliederungen werden
u. a. die Selbständigkeit der Führungsorgane, eine flexiblere
Personalwirtschaft sowie bessere Finanzierungs- und
Kooperationsmöglichkeiten genannt.[52]
Die Kommunen verfügen über
1.410.000 Bedienstete, die sich aus
Angestellten (907.000), Arbeitern (326.000) und Beamten (177.000)
zusammensetzen.[53]
3.1.6 Finanzierung
Haupteinnahmequellen der Kommunen sind
Steuern und allgemeine
Zuweisungen von Bund und Ländern. Erst an dritter Stelle stehen
Gebühren, die - im Gegensatz zu Steuern und Zuweisungen - als
Entgelt
für erbrachte Leistungen der Kommune eingenommen werden.
Die wichtigste Einnahmequellen der
Kommunen sind (in Klammern die Ergebnisse 2003)[54]:
1. Steuern (47 Mrd. €), insbes. Anteil
an der Einkommens- und Körperschaftsteuer (20) und Gewerbesteuer
(15 Mrd. €),
2. laufende Zuweisungen vom Bund und
von den Ländern (38 Mrd. €) und
3. Gebühreneinnahmen (16 Mrd. €).
Den Einnahmen stehen die
Hauptausgabeblöcke
- Personal (41 Mrd. €),
- Soziale Leistungen (30 Mrd. €) und
- Sachaufwand (29 Mrd. €)
gegenüber.
„Mehr als die Hälfte ihrer
Steuereinnahmen geben die Kommunen unmittelbar für soziale
Leistungen aus.“[55]
3.1.7 Stadtwerke[56]
In Deutschland bezeichnen sich rund
1.000 Versorgungsunternehmen als
Stadtwerke (Stand 08/2003).[57] Bei 12 dieser rund 1.000 Stadtwerke ist
die Beteiligung privater Unternehmen größer als 50 %. Es
wird davon
ausgegangen, dass in diesen Unternehmen die Kommunen keinen
bestimmenden Einfluss ausüben, so dass entsprechend der in Kapitel
3.1.5 getroffenen Definition nicht von
kommunalen Unternehmen
gesprochen werden kann.
Mehr als zwei Drittel der kommunal
bestimmten Stadtwerke befinden
sich in alleiniger Hand der Kommunen wie die nachfolgende Abbildung
verdeutlicht.
Abbildung 5:
Eigentumsverhältnisse an kommunalen Stadtwerken 08/2003
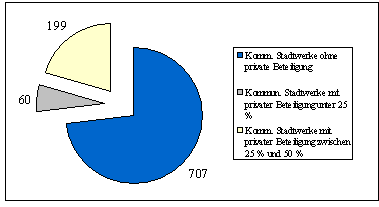
Quelle: Eigene Darstellung in
Anlehnung an: Verband kommunaler Unternehmen (2003b), S. 1
Die meisten Stadtwerke betreiben
mehrere Sparten. Dabei werden
oftmals gewinnbringende Sparten wie Strom und Gas mit typischen
Verlustträgern wie Bädern oder Verkehr kombiniert, um in
einem
steuerlichen Querverbund die Gewinne mit den Verlusten verrechnen zu
können. Die Zielsysteme der Stadtwerke sind mehrdimensional. Neben
der
Sicherstellung der Versorgung, Preisgünstigkeit und
Umweltverträglichkeit sollen Stadtwerke auch einen Ertrag für
den
Haushalt der Gemeinde abwerfen, der mindestens eine marktübliche
Verzinsung des Eigenkapitals beinhaltet. Da die genannten Ziele
teilweise in einem Konflikt zueinander stehen, wird von einigen
Stadtwerken in Anlehnung an das in der Wirtschaft dominierende Ziel des
„shareholder value“ die Maxime des „citizen value“ („Wertschöpfung
für
Bürgerinnen und Bürger“[58]) ausgegeben.
Die Wirtschaftstätigkeit von
Stadtwerken wird in den
Gemeindeordnungen mit Ausnahme der liberalisierten Bereiche (insbes.
Elektrizität und Gas) in der Regel auf das kommunale Gebiet
beschränkt.
Außerdem wird die Wirtschaftstätigkeit regelmäßig
auf die Erfüllung
eines öffentlichen Zwecks beschränkt. Zum Teil sehen die
Gemeindeordnungen darüber hinaus vor, dass die wirtschaftliche
Betätigung nur zulässig ist, „wenn der Zweck nicht besser
oder
wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden kann (so
genannte
Subsidiaritätsklausel).“[59]
Die Situation der wichtigsten Sparten
soll kurz skizziert werden (in
Klammern: Umsätze und Marktanteile der Stadtwerke 2003):[60]
- Strom (Umsatz 22 Mrd. €,
Marktanteil 53 %): Seit der Öffnung der
Strommärkte im Jahr 1998 stehen die Stadtwerke im Wettbewerb mit
nationalen und internationalen Anbietern, konnten ihre Marktanteile
jedoch behaupten. Etwa 21 % des Stroms erzeugen die Stadtwerke in
eigenen Anlagen.[61]
- Gas (Umsatz 20 Mrd. €, Marktanteil
52 %): Die Öffnung der Märkte
erfolgte ebenfalls 1998, hat jedoch im Gegensatz zum Strom bisher kaum
zu Wettbewerb geführt.
- Wasser (8 Mrd. €, Marktanteil 75
%): Die Wasserversorgung ist nach
dem Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung regelmäßig von
den
Kommunen durchzuführen und steht derzeit nicht im Wettbewerb. 25 %
der
Versorgung erfolgen durch private Unternehmen und durch Eigenversorgung
der Verbraucher.
- Wärme (3 Mrd. €, Marktanteil
73 %): Kommunen erzeugen Wärme in Nah-
und Fernwärmeanlagen und versorgen damit Einheiten
unterschiedlichster
Größenordnung von ganzen Baugebieten über
Produktionshallen bis hin zu
Einfamilienhäusern. Oftmals wird die Wärmelieferung als
Contracting[62]
abgewickelt. Im Bereich der Wärmelieferung stehen die Kommunen im
Wettbewerb zur freien Wirtschaft.
- Verkehr (0,7 Mrd. €,
Marktanteilszahlen liegen nicht vor): Die
Kommunen als gesetzlicher Aufgabenträger verbuchen mit dem
ÖPNV trotz
vielfältiger Förderungen von Bund und Ländern hohe
Verluste. Oftmals
führen die Kommunen den ÖPNV mit eigenen Verkehrsbetrieben
durch, so
dass nur ein geringer Wettbewerb stattfindet.
3.2 Bewertung der Lage und der
zukünftigen Herausforderungen
3.2.1 Die Lage der Kommunen
Das größte Problem vieler
Kommunen ist ihre Finanzkrise. Die Schere
zwischen steigenden Aufgaben auf der einen Seite und sinkenden
Einnahmen auf der anderen Seite hat sich so weit geöffnet, dass
die
Kommunen im Jahr 2003 ein Finanzierungsdefizit von 9,7 Mrd. €
aufwiesen.[63] Die Finanzkrise lässt sich maßgeblich auf
eine verfehlte
Bundes- und Landesgesetzgebung zurückführen, auf die die
Kommunen kaum
Einfluss haben.[64] Zwei Beispiele sollen diese Feststellung belegen:
- Die Haupteinnahmequellen der
Kommunen, die Gewerbesteuer und der
Anteil an der Einkommensteuer, sind in den vergangenen Jahren - bedingt
durch Steuererleichterungen, eine höhere Gewerbesteuerumlage an
Bund
und Länder sowie die konjunkturelle Talfahrt - stark
rückläufig. Allein
zwischen den Jahren 2000 und 2003 gingen diese Einnahmen der Kommunen
um 5,9 Mrd. € zurück. Die Gewerbesteuer ist nicht nur in ihrer
absoluten Höhe gesunken, erhebliche Probleme bereiten den
einzelnen
Kommunen daneben auch hohe Aufkommensschwankungen.
- Der zweitgrößte
Kostenblock der Kommunen, die Ausgaben für soziale
Leistungen, sind von 2000 bis 2003 um 3 Mrd. € auf 30 Mrd. € gestiegen.
Auch auf diese bundesgesetzlichen Sozialgesetze haben die Kommunen
keinen Einfluss, müssen aber die Aufgaben ausführen und
Ausgaben
tragen. Innerhalb der sozialen Leistungen entfallen 11 Mrd. €
auf die
Eingliederungshilfen für Behinderte (z.B. für betreutes
Wohnen, Arbeit
in Behindertenwerkstätten), eine Aufgabe, die der Deutsche
Städte- und
Gemeindebund zu Recht als gesamtgesellschaftliche und nicht primär
kommunale Aufgabe bezeichnet.
Bereits 65 % der kommunalen
Steuerausgaben mussten die Kommunen im Jahr 2003 für soziale
Aufgaben verwenden.
Die kommunalen Spitzenverbände
beklagen, „dass die Kommunen aufgrund
eines Entzuges politischer Handlungsspielräume zusehends von einer
politisch-administrativen Ebene zu einer rein administrativen Ebene
mutieren“.[65] Es genügt nicht, diese Entwicklung allein auf den
Bund
und die Länder zurückzuführen. Vielmehr haben die
Kommunen in
konjunkturellen Hochphasen regelmäßig keine Vorsorge
für schwächere
Phasen getroffen, sondern sind im Gegenteil langfristige
Verpflichtungen eingegangen.
Neben der schlechten Finanzlage stehen
die Kommunen vor eine Reihe
weiterer Herausforderungen. Beispielhaft werden einige wichtige Punkte
genannt:
- Aufbau von
Ganztagsbetreuungsangeboten für Kinder bis zu 3 Jahren
- Verödung der Innenstädte
- Demografischer Wandel (Alterung und
Abnahme der Bevölkerung, wachsender Migrantenanteil)[66]
- Kommunalpolitische Krise:
„Mitgliederschwund, Nachwuchsprobleme im Rat, sinkende
Wahlbeteiligung“[67]
- Spezielle Probleme von Kommunen in
den neuen Bundesländern: Abwanderung, Arbeitslosigkeit,
Wohnungsleerstände, etc.
- Stärkere Einbeziehung der
ausgegliederten Beteiligungen in die Gesamtsteuerung der Kommune im
Sinne einer „Konzernsteuerung“
3.2.2 Betrachtung der Stadtwerke
Der Bereich der Stadtwerke ist seit
einigen Jahren von einem
erheblichen Strukturwandel in Form von Kooperationen, Fusionen und
vertikalen Integrationen geprägt. Auch ausländische Anbieter
verschaffen sich Zutritt zum deutschen Energiemarkt.
Neben der Struktur der Stadtwerke als
Ganzes sind auch die einzelnen
Sparten derzeit von erheblichen Änderungen ihres Umfeldes
betroffen
oder bedroht. Besonders die Energiemärkte weisen eine große
Dynamik
auf, wie die folgende Grafik veranschaulicht.
Abbildung 6: Herausforderung Dynamik
in der Energiewirtschaft
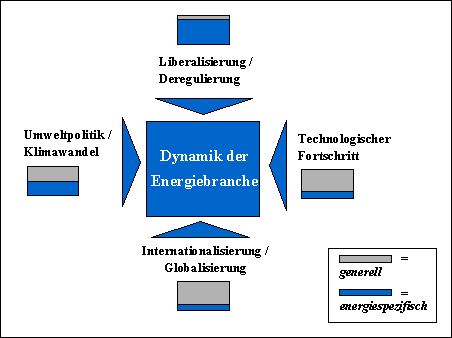
Quelle: Eigene Darstellung in
Anlehnung an: Stadtwerke Flensburg (2005a)
Den umfassendsten rechtlichen Einfluss
übt die EU mit Regelungen zum
europäischen Binnenmarkt aus. Auf Bundesebene sind die
Wirtschaftspolitik (u. a. Energiepolitik, Wettbewerbspolitik),
Steuerpolitik und Umweltpolitik zu nennen. Seitens der Länder
wirken
sich besonders die Kommunalgesetze, Umweltgesetze und
Förderrichtlinien
für den ÖPNV aus.
Die Perspektiven der einzelnen Sparten
stellen sich wie folgt dar:
- Strom, Gas, Wärme: Zur
Umsetzung von EU-Vorgaben wird das deutsche
Energiewirtschaftsrecht voraussichtlich Mitte 2005 erheblich
verändert.
Das modifizierte Recht wird umfangreiche Verpflichtungen zur
Entflechtung des Netzbetriebs von anderen Tätigkeiten vorsehen
(informatorisches[68], buchhalterisches[69], rechtliches[70] und
operationelles[71] Unbundling). Damit soll Wettbewerbern eine
diskriminierungsfreie Nutzung des Netzes ermöglicht werden.
Für die
Regulierungsaufgaben des Energiewirtschaftsrechts wird derzeit eine
weitere Bundesbehörde aufgebaut, die den Markt neben dem bereits
tätigen Bundeskartellamt kontrollieren soll.[72] Für die
Energieversorgungsunternehmen sind mit dem geänderten Energierecht
Risiken wie bürokratischer Aufwand, Synergieverluste, geringere
Investitionssicherheit und ein verschärfter Wettbewerb[73]
verbunden.
Darüber hinaus sind die Preise derzeit Gegenstand wachsender
Proteste
von Verbrauchern. In diesem dynamischen Marktumfeld wirken sich die
Beschränkungen der Gemeindeordnungen (z.B. das
Subsidiaritätsprinzip)
nachteilig aus, da die Stadtwerke nur begrenzte Möglichkeiten zum
Wachstum und zur Diversifikation besitzen.
- Wasser: Auch die Wasserversorgung
ist Ziel von
Liberalisierungsbestrebungen der EU-Kommission, wenngleich diese vom
EU-Parlament bereits einmal zurückgewiesen wurden.
- ÖPNV: Der defizitäre
ÖPNV wird zunehmend eingeschränkt, da zum
einen der Bund und die Länder ihre Fördergelder kürzen
und zum anderen
die Kommunen die Defizite in diesem Bereich aufgrund ihrer Finanzkrise
reduzieren müssen.
Für viele Stadtwerke ist ferner
die Frage von erheblicher Bedeutung,
ob die Kommunen ihre ausgegliederten Unternehmen im Rahmen ihres
Organisationsermessens ohne europaweite öffentliche Ausschreibung
konzessionieren[74] oder beauftragen dürfen. In der Praxis wurde
dies
bis zuletzt regelmäßig so gehandhabt. Ein neues Urteil des
Europäischen
Gerichtshofs vom 11.01.05 schränkt dieses Vorgehen jedoch im
Bereich
von Dienstleistungsaufträgen ein, was das Ende für zahlreiche
Privatisierungsmodelle darstellen könnte.[75] Nach diesem Urteil
darf
nicht auf eine Ausschreibung verzichtet werden, wenn an einem
Unternehmen neben der Kommune auch private Unternehmen beteiligt sind.
Auf die Höhe der privaten Beteiligung kommt es nicht an.
Die Frage der Notwendigkeit einer
öffentlichen Ausschreibung ist für
kommunale Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Durch
Ausschreibungsniederlagen könnte ein kommunales Unternehmen
gleichzeitig seine Aufgaben verlieren, da ein Ausweichen auf andere
Orte oder Produkte rechtlich nur sehr eingeschränkt möglich
ist. In
Ermangelung von Aufgaben müsste das kommunale Unternehmen dann
aufgelöst werden. Für die Kommunen kann dies zur Folge haben,
dass es
dauerhaft auf Fremdleistungen angewiesen ist, da sich das nicht mehr
existente Unternehmen nicht an späteren Ausschreibungen beteiligen
kann.[76]
Dienstleistungskonzessionen werden von
dem Urteil des EUGH zwar
nicht erfasst, doch auch in diesem Bereich erwägt die
EU-Kommission
weitere Liberalisierungen.[77]
|


